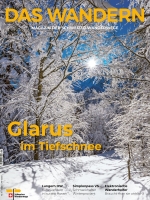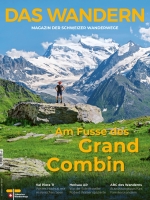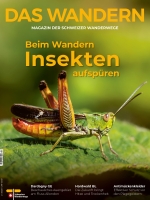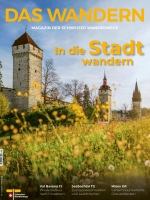Zur Hirschbrunft ins Val Mingèr
Im Schweizerischen Nationalpark gibt es zwei Gebiete, um den König des Waldes zu beobachten: Das bekanntere ist das Val Trupchun, das von S-chanf aus einfach erreicht werden kann. Das schönere hingegen ist das Val Mingèr, ein abgelegenes Hochtal weit unten im Engadin. Zwischen Mitte September und Mitte Oktober stehen hier die Chancen gut, Hirsche bei der Brunft zu sehen – oder zumindest zu hören. Und hat man einmal kein Glück, so entschädigt einen die unberührte Naturlandschaft mit Föhrenwäldern, rauschenden Bergbächen und wilden Felszacken. Während der Sommersaison fährt ein Postauto vom Thermalkurort Scuol das Val S-charl hinauf bis zur Verzweigung beim Val Mingèr. So spart man lange Wanderkilometer der Talstrasse entlang. An der Haltestelle zeigt der Wegweiser in Richtung Sur Il Foss, einem Zwischenziel dieser Tour. Der Wanderweg führt sogleich von der Strasse weg und dem Wasser entlang in die Abgeschiedenheit des Nationalparks. In den Lärchen- und Föhrenwäldern im Talboden und an den Hängen des Piz Mingèr und des Piz dals Cotschens werben die Hirsche im Herbst lautstark um die Gunst der Hirschkühe. Auch wenn es vielleicht bessere Beobachtungsposten gäbe, darf der Weg im Nationalpark nie verlassen werden, und Picknicks sind nur an den dafür vorgesehenen Rastplätzen erlaubt. Zudem ist Hunden der Zutritt untersagt. Der Weg steigt ständig an bis zum 2316 Meter über Meer gelegenen Übergang Sur il Foss. Dieser bildet gleichzeitig die Grenze des Parks. Dahinter öffnet sich ein weiteres prächtiges Bergtal, das Val Plavna, das im Gegensatz zum Val Mingèr von Alpwirtschaft geprägt ist. Dem Wegweiser Richtung Tarasp Fontana folgend, führt der Wanderweg nun an der Alp Plavna vorbei wieder hinunter ins Engadiner Haupttal. Von Tarasp Fontana fährt ein Postauto zurück nach Scuol.
Nur noch vereinzelt hallt der sonore Bass der röhrenden Stiere durch das Val Mingèr, und nur noch geschulte Augen entdecken an den Sonnenhängen des Piz dals Cotschens einzelne grasende Hirschkühe. Der frühe Schnee hat das Rotwild schon Anfang Oktober in tiefere Lagen getrieben. Umso mehr Zeit bleibt Annina Buchli auf der Wanderung durch den Nationalpark von der Faszination des Geweihten zu erzählen, von Kämpfen und Paarungsritualen, von Ausrottung und Überpopulation, von Mythen und neuen Erkenntnissen.
Annina Buchli arbeitet nun schon die fünfte Saison für den Schweizerischen Nationalpark und leitet jedes Jahr rund 30 Exkursionen in Romanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Anstatt ins Val Trupchun, wo sich zur Brunftzeit manchmal mehrere Hundert Personen an den Rastplätzen auf den Füssen herumstehen, führt sie an diesem Tag ins Val Mingèr, ein landschaftlich faszinierendes Hochtal zwischen Scuol und Ofenpass. Das Tal ist eines der sogenannten Sommereinstandsgebiete der Hirsche. Hier hinauf ziehen sie im Frühling, wenn der Schnee langsam schmilzt und das Gras zu wachsen beginnt. Im Herbst wandern sie dann die vielen Kilometer wieder zurück in ihre Winterquartiere im Engadiner Haupttal oder in den Südbündner Tälern. «Sie sind ständig von der Suche nach Nahrung und Ruhe getrieben», begründet Annina Buchli die langen Wanderungen.
Geforderter Platzhirsch
Zwischen den Ortswechseln liegt die Brunftzeit, die so viele Menschen fasziniert und den Hirsch zum Sinnbild für Kraft und Potenz hat werden lassen. Sie beginnt um den 10. September herum und erreicht ihren Höhepunkt gegen Ende des Monats. Sobald die Hirschkühe ihren Eisprung haben und für die Stiere unwiderstehlich zu riechen beginnen, gibt es kein Halten mehr. Die Männchen, die den ganzen Sommer über unter sich gelebt haben, suchen dann unaufhaltsam die Nähe der Weibchen. Mit lautstarkem Röhren versuchen sie den Kühen zu imponieren und gleichzeitig Rivalen abzuschrecken. Meistens zeigt das Wirkung. Lässt sich allerdings ein Nebenbuhler nicht beeindrucken, kommt es zu Kämpfen, die für den Unterlegenen manchmal tödlich enden können.
Haben die Stiere ihre Rangordnung einmal geregelt, deckt der sogenannte Platzhirsch einen ganzen Harem mit diversen Kühen. Zum Fressen kommt er bei dieser anstrengenden Aufgabe kaum noch und verliert deshalb während der Brunft bis zu einem Drittel seines Gewichts. Klappt es bei einer Kuh nicht beim ersten Mal, hat sie drei Wochen später nochmals einen Eisprung, wird erneut gedeckt und wirft im darauffolgenden Frühling mit ziemlicher Sicherheit ein Kalb. Zusammen mit ihrem letztjährigen Kalb führt sie dieses durch einen neuen Jahreszyklus. Bereits mit zwei Jahren können die Kälber dann schon selbst trächtig werden.
Spuren vom Dampfablassen
Der Wanderweg durch das Val Mingèr führt durch Lärchen- und Föhrenwälder dem Wildbach Ova da Mingèr entlang ständig bergauf. Das Wasser befördert hier so viel Geschiebe von den umliegenden Steilhängen herunter, dass sich die Landschaft immer wieder verändert. Dort, wo der Weg noch immer der uralten Routenführung folgt, sind öfters dunkle Stellen sichtbar, wo lange vor der Gründung des Nationalparks Kohlemeiler angezündet wurden.
Die Wiesen auf den Lichtungen sind abgeweidet wie auf einer Alp, obschon im ganzen Tal seit über 100 Jahren jegliche Nutzung verboten ist. «Das sind deutliche Spuren der Hirschpopulation», weiss Annina Buchli. Sie zeigt auch auf abgeschabte Baumrinde, wo sich Hirsche den Bast vom Geweih gefegt haben, und auf völlig verdroschene Büsche. «Hier haben Stiere wahrscheinlich Dampf abgelassen, weil sie während der Brunft nicht zum Zug gekommen sind», sagt Buchli.
Nicht nur Freude
Im Nationalpark können die Hirsche tun und lassen, was sie wollen. Neben Steinböcken, Adlern, Bartgeiern und vielleicht noch dem Tannenhäher – dem Wappentier des Parks – gehören sie hier zu den Stars. Ausserhalb des geschützten Gebiets sorgen sie hingegen öfters für Ärger. Im Sommer tun sie sich in tieferen Lagen gerne an Maisfeldern gütlich, und im Winter fressen sie so viel Baumrinde und junge Zweige, dass sogar Schutzwälder gefährdet werden können. Während Jahrzehnten war das Verhältnis zwischen Mensch und Hirsch deshalb beinahe so angespannt, wie heute dasjenige zwischen Mensch und Wolf.
Im 19. Jahrhundert galt der Hirsch in der Schweiz als ausgerottet. Die Zerstörung seiner Lebensräume und die intensive Jagd hatten ihm den Garaus gemacht. In den 1860er- und 1870er-Jahren wurden dann aber im österreichischen Vorarlberg Hirsche ausgesetzt, die schliesslich auch wieder ins Engadin einwanderten. Vor allem im 20. Jahrhundert wuchs die Population so schnell, dass sich Konflikte mit Land- und Forstwirtschaft häuften und der Ruf nach stärkerer Regulation lauter wurde.
Als in den 1960er-Jahren das sogenannte Wintersterben einsetzte, wurde klar, dass eine natürliche Grenze erreicht war. Annina Buchli kennt Bilder aus alten Zeitungen, auf denen grosse Stapel toter Hirsche zu sehen sind, die im Winter wegen Nahrungsmangel verendet waren. Heute werden in Graubünden jedes Jahr 5000 Hirsche geschossen. So wird der Bestand bei rund 15 000 Tieren stabil gehalten. Sogar im Nationalpark haben Parkwächter bis vor 30 Jahren noch einige Hirsche erlegt, was unterdessen als Sündenfall bezeichnet wird. Heute leben die rund 2000 Parkhirsche wieder völlig ungestört.
Neuer Jäger
Wobei: Ein neuer Jäger setzt den König der Wälder zunehmend unter Druck. 2023 hat sich in der Nationalparkregion ein Wolfsrudel angesiedelt, das sogenannte Fuorn-Rudel. Obschon ein ausgewachsener Hirsch mit imposantem Geweih wenig zu befürchten hat, passt junges Rotwild genau ins Beuteschema der Wölfe. «Die Wölfe haben einen Einfluss auf das Verhalten der Hirsche und auf das ganze Ökosystem im Nationalpark», sagt Annina Buchli. Die Wanderungen der Hirsche seien weniger berechenbar geworden. «Statt grossen Rudeln sehen wir heute eher kleinere Gruppen». Vermutet wird, dass die Hirsche damit das Risiko von Wolfsangriffen minimieren. Und wenn weniger Tiere dieselbe Weide beäsen, verändert sich dadurch auch die Vegetation. Heute stünden die Bergwiesen teilweise höher, und es seien mehr Blumen zu sehen, sagt Annina Buchli. Dem Fuorn-Rudel ging es aber bereits an den Kragen. Letztes Jahr hat es das Bundesamt für Umwelt zum Abschuss freigegeben, da es zwei Kälber oder Rinder gerissen haben soll. Mittlerweile wurden 14 Wölfe ausserhalb des Nationalparks und gegen dessen Willen geschossen.
Plan B muss her
Im oberen Teil des Val Mingèr macht Annina Buchli Pause, auf dem einzigen offiziellen Rastplatz im Tal. Im ganzen Nationalpark dürfen die offiziellen Wanderwege nicht verlassen werden, und Picknick ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt.
Annina Buchli nimmt ihr Fernglas zur Hand und sucht die gegenüberliegenden Hänge ab. Liegt da ein Hirsch unter der knorrigen Arve an der Sonne? Fressen sich dort Jungtiere kurz vor dem Winter noch Reserven an? Gämsen findet sie zuhauf, doch das grosse Treffen der Hirsche zur Brunftzeit ist schon vorbei.
Dafür zieht Annina Buchli aus einer am Boden verankerten Aluminiumkiste einen Hirschschädel samt Geweih hervor. Die Exkursionsleitenden haben hier Anschauungsmaterial deponiert, falls die Natur einmal nicht so viel bietet, wie erhofft. Ein verblichener Achtender – ein Geweih mit acht Enden – muss die Lücke füllen.
Der Mythos der Geweihenden
Hirschkühe können bis zu 20 Jahre alt werden. Stiere hingegen, die insbesondere während der Brunft höhere Risiken eingehen und wenig Nahrung zu sich nehmen, erreichen eher nur 16 Jahre. Tatsächlich legen die Stiere zwar mit jedem Lebensjahr an Geweihmasse zu, dass aber jedes Ende für ein Altersjahr stehe, sei ein Mythos, sagt Annina Buchli. Vierzehnender sind schon eine ziemliche Seltenheit, es gibt aber durchaus auch noch mächtigere Geweihe. Wenn man bedenkt, dass Hirschstiere jedes Jahr Ende Winter ihr Geweih abstossen und wieder ein neues bilden, ist dies schon beeindruckend.
Annina Buchli erklärt, wo man Hirsche sieht.
Ausserhalb des Parks wird ein Teil der abgeworfenen Geweihstangen von lokalen Jägern als Trophäen oder für den Verkauf eingesammelt. Sie wissen genau, ab wann die Hirsche oben ohne rumlaufen und machen sich dann auf die Suche. Diese sogenannte Stangensuche ist allerdings unerwünscht und im Nationalpark streng verboten, da sie mit massiven Störungen der Tiere verbunden ist. Bleibt ein Geweih unentdeckt, wird es oft von Nagetieren gefressen. Sogar Hirsche selbst nagen an abgeworfenen Stangen.
Während Annina Buchli vom Hirsch erzählt, wird sie schnell von anderen Wandernden umringt. Der Geweihte interessiert eben sehr, und gerade der Geweihwechsel birgt eine besondere Faszination. Manche sehen darin ein Symbol für die Wiederauferstehung und schreiben dem Hirsch gar etwas Göttliches zu. Was immer man davon hält, das grösste Wildtier der Schweiz zieht einen auf jeden Fall in seinen Bann.

Tipp
Wer mehr über Hintergründe und Geschichte des Nationalparks erfahren oder auch nur ein Fernglas für Tierbeobachtungen ausleihen möchte, dem sei das Nationalparkzentrum in Zernez empfohlen. Hier kommen übrigens auch Kinder auf ihre Rechnung.