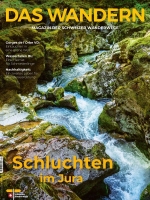Magazin DAS WANDERN

Das Magazin der Schweizer Wanderwege
DAS WANDERN nimmt Sie mit auf spannende Reportagen quer durch die Schweiz, führt Gipfelgespräche mit inspirierenden Persönlichkeiten, präsentiert neue Wandervorschläge, spürt Trends auf und teilt praktische Tipps. Nah an den Menschen, der Natur und den Geschichten, die es rund ums Wandern zu erzählen gibt.
-
Unterwegs in Schluchten
Entdecken Sie die Magie der Schlucht der Pouetta Raisse NE, tauchen Sie ein in die schattigfeuchte Welt der Gorges de l’Orbe VD, und begleiten Sie uns auf der Suche nach Wasser in der Biaufond-Schlucht NE/BE/JU.
-
Nachhaltig und preiswert
Wie kann die Lebensdauer von Wanderkleidern und -ausrüstung verlängert werden? Wir haben da ein paar Ideen
-
Ein Lebensraum für Schmetterlinge
Von der Krete bei der Wasserfallen BL/SO gibt es viel zu sehen – auch viele Schmetterlinge.
Abonnement
DAS WANDERN erscheint sechs mal jährlich.
Sind Sie an einem Abo interessiert, aber noch unschlüssig? Dann senden wir Ihnen gerne eine kostenlose Probenummer zu. Übrigens: unser Abonnement gibt es als Geschenkabo.
Entdecken Sie hier die exklusiven Vorteile für Abonnent:innen!
Unsere Abonnements
Jahresabo
74.- inkl. MwSt.
Geschenkabo
74.- inkl. MwSt.
Schenken Sie das Magazin DAS WANDERN im Jahresabo, sechs Ausgaben inkl. Online-Zugang.
Probenummer
0.- / Gratis
Erhalten Sie eine Probenummer von DAS WANDERN und entscheiden Sie später, ob Sie ein Abonnement bestellen möchten.
Vorteile für Abonnent:innen
-
*Bedingungen zur Gewährung des 50% Rabatts auf Parktickets am Wochenende (Fr., Sa., So.) in der P+Rail-App
Der Rabatt ist jeden Freitag, Samstag und Sonntag gültig.
- Der Promotionscode ist für die Parkplätze dieser
Transportunternehmen gültig: SBB AG, Appenzeller Bahnen, Aargau Verkehr AG, BLS
AG, Jungfrau Railways, Regionalbahn Bern-Solothurn, Rhätische Bahnen,
Südostbahn, Die Zentralbahn
- Der Rabatt wird nur über die P+Rail-App gewährt.
So funktionierts:P+Rail-App auf Smartphone installieren, die gewünschte P+Rail-Anlage wählen und beim Auschecken den Rabattcode auf Ihrem Mitgliederausweis eingeben. - Der Promotionscode ist für die Parkplätze dieser
Transportunternehmen gültig: SBB AG, Appenzeller Bahnen, Aargau Verkehr AG, BLS
AG, Jungfrau Railways, Regionalbahn Bern-Solothurn, Rhätische Bahnen,
Südostbahn, Die Zentralbahn
-
*Bedingungen zur Gewährleistung des 15% Buchungsrabatts bei den Schweizer Jugendherbergen
Die Schweizer Jugendherbergen gewähren 15% Rabatt auf alle Übernachtungen in den Schweizer Jugendherbergen. Ausgenommen: Gruppenhäuser (Château-d’Oex, Fällanden, Sils) sowie Saignelégier, Scudellate und St. Luc (Stand November 2023). Nach Verfügbarkeit auf offiziell publizierte Preise: booking.youthhostel.ch
Gültig: 7.1.2024 – 24.12.2024
Buchungsbedingungen
- Nicht gültig für Gruppen ab 10 Personen, auf bestehende Buchungen und nicht kumulierbar mit anderen Spezialangeboten oder Rabatten. Keine Barauszahlung. Nur 1 Code pro Buchung einlösbar.
- Bitte die Annullationsbedingungen und die AGB während des Buchungsprozesses beachten.
- Keine Reduktion auf die Kindertarife und Zusatzleistungen.
- Online Buchungen über booking.youthhostel.ch
So funktionierts:
Geben Sie im Feld «Promotion-Code eingeben» den Rabattcode ein, welchen Sie auf Ihrem Gönner-, Leser- oder Mitgliederausweis oder in Ihrem Account auf schweizer-wanderwege.ch finden.
-
*Bedingungen zur Gewährung des 15% Buchungrabatts in den Arenas The Resorts und Faern Resorts
Arenas The Resorts und Faern Resorts gewähren 15% Buchungsrabatt unter folgenden Bedingungen:
- 15% Rabatt auf Übernachtungen inkl. Halbpension in der gewünschten Zimmerkategorie
- Gültig bei neuen Direktbuchungen online unter Angabe des Buchungscodes auf dem Gönnerausweis in den Arenas The Resorts in Sils-Maria und Wengen sowie in den Faern Resorts in Arosa und Crans-Montana. Mindestaufenthalt von 3 Nächten
- Gültig nur für Neubuchungen unter Angabe des Rabattcodes auf dem Gönner-, Leser- oder Mitgliederausweis. Der Rabattcode ist zwingend bei der Buchung anzugeben. Erfolgt die Angabe erst vor Ort ist der Rabatt ungültig.
- Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten und Vergünstigungen
- Gültig während der Sommersaison (1.6. - 31.10.2024)
- Gültig für Gönner:innen der Schweizer Wanderwege, jeweils inklusive 1 Begleitperson im gleichen Zimmer
So funktionierts:
Geben Sie im Feld «Promotionscode» oder «Aktionscode» den Rabattcode ein, welchen Sie auf Ihrem Gönnerausweis finden.
- 15% Rabatt auf Übernachtungen inkl. Halbpension in der gewünschten Zimmerkategorie
-
*Bedingungen zur Gewährung des 20% Rabatts auf auf das ganze LOWA-Socks Sortiment im Onlineshop
- Der Rabatt ist nur auf lowaathome.ch gültig
- Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kumulierbar
- Es gelten die offiziellen AGB von lowaathome.ch
- Angebot gültig vom 1.4.2024 bis 31.3.2025
So funktionierts:
Beim Zahlvorgang den Rabattcode auf Ihrem Mitgliederausweis eingeben.
- Der Rabatt ist nur auf lowaathome.ch gültig
-
*Bedingungen zur Gewährleistung des 10%-Einkaufsrabatts bei Transa
Transa Travel & Outdoor gewährt 10% Einkaufsrabatt unter folgenden Bedingungen:
- Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.
- Der Rabatt ist nicht gültig bei Sonderbestellungen (Artikel, die nicht im Transa-Sortiment geführt, jedoch auf Kundenwunsch bei den Lieferanten bestellt werden).
- Der Rabatt ist nicht gültig beim Kauf von Geschenkkarten.
- Der Rabatt ist nicht gültig bei Reparaturen und sonstigen Dienstleistungen.
- Der Rabatt gilt sowohl bei Einkäufen in den Filialen wie auch im Online-Shop von Transa. In den Filialen wird der Rabatt nur auf Vorweisen des Gönnerausweises (bei Mitgliedern «Mitgliederausweis», bei Abonnenten «Leserausweis») gewährt.
So funktionierts:
Geben Sie bei Online-Bestellungen den Rabattcode auf Ihrem Gönnerausweis (bei Mitgliedern «Mitgliederausweis», bei Abonnenten «Leserausweis») ein oder weisen Sie bei Einkäufen in den Filialen den Gönnerausweis vor.
-
*Bedingungen zur Gewährleistung des Buchungsrabatts von CHF 50.- bei Reka
Die Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft gewährt einen Buchungsrabatt von CHF 50.- ab drei Nächten unter folgenden Bedingungen:
- CHF 50.- Rabatt für Reka-Ferien in der ganzen Schweiz im Ferienzeitraum vom 08.03. bis 06.07.2024 und vom 16.08. bis 02.11.2024.
- Gültig für das gesamte Angebot in der Schweiz, exkl. Reka-Ferienhilfe.
- Gültig bei Direktbuchung per Telefon unter 031 329 66 99 oder online via reka.ch
- Gültig für Neubuchungen, die zwischen dem 06.10.2023 und dem 31.10.2024 getätigt werden, unter Angabe des Rabattcodes auf Ihrem Gönnerausweis. Der Rabattcode muss zum Zeitpunkt der Buchung bekannt gegeben werden, spätere Nennungen können nicht berücksichtigt werden. So funktionierts: den Promocode bei Online-Buchung eingeben, bei telefonischer Buchung mitteilen.
- Mindestaufenthalt 3 Nächte
- Nicht kumulierbar mit anderen Promotionen, nur 1 Gutschein pro Buchung, keine Barauszahlung
- Nicht gültig auf bereits abgeschlossene Buchungen und bezahlte Rechnungen
- Angebot gültig nach Verfügbarkeit
So funktionierts:
Geben Sie bei Online-Buchungen und Buchungen per Telefon den Rabattcode auf Ihrem Gönnerausweis (bei Mitgliedern «Mitgliederausweis», bei Abonnenten «Leserausweis») an.
Mediadaten
Ihre Werbung im Magazin DAS WANDERN
DAS WANDERN ist das Magazin der Schweizer Wanderwege. Mit 264 000 regelmässigen Leserinnen und Leser (MACH BASIC 2022-2) und einer Druckauflage von 34 250 Exemplaren ist es die stärkste Wanderzeitschrift der Schweiz. Das Magazin erscheint sechs Mal jährlich auf Deutsch und Französisch sowie als Print- und Digitalausgabe.
Jahresinhalt
Jahresinhaltsverzeichnis
In diesen Jahresinhaltsverzeichnissen sind die vielen attraktiven Reportagen, spannenden Geschichten und abwechslungsreichen Wanderungen der Autorinnen und Autoren von DAS WANDERN (ehemals WANDERN.CH) von 2013 bis 2023 zusammengefasst.